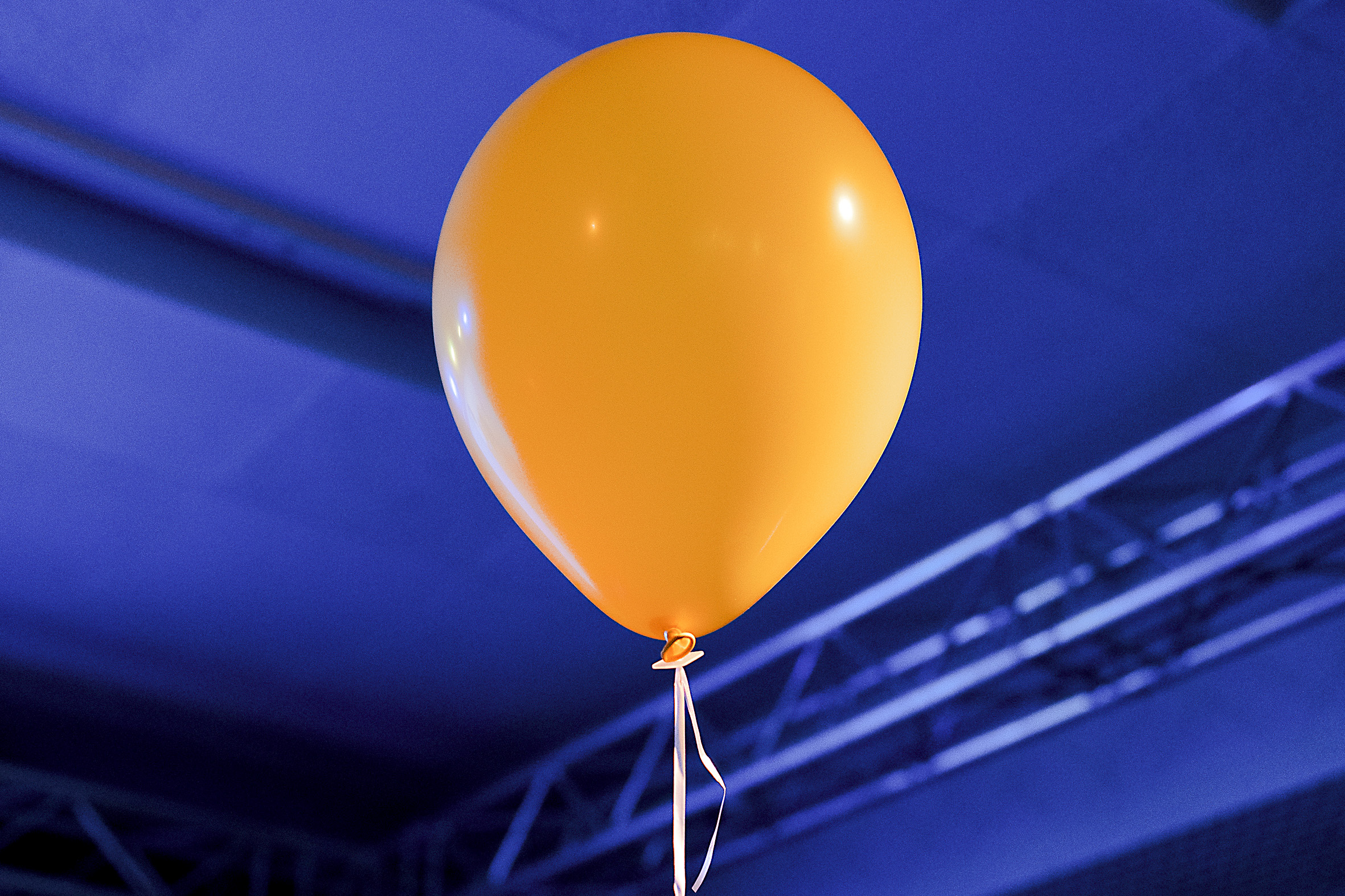Kein Beitritt auf Augenhöhe
mehrOffen und frei von Beschönigungen debattierte die Landeszentrale am 4. Dezember über das deutsch-deutsche Verhältnis 1989/90 und die Ursachen wieder einsetzender Entfremdung nach 35 Jahren formaler staatlicher Einheit.
Warme Mädchenfreundschaft im Kalten Krieg
mehrEine Begegnung der Landeszentralen von Baden-Württemberg und Sachsen in Chemnitz wird flankiert von einer deutsch-deutschen „Erlebnislesung“
„Daß ein gutes Deutschland blühe - Wie ein andres gutes Land“
mehrDer Schauspieler Roman Knižka und das Musikensemble OPUS 45 beschäftigen sich in einem Programm mit der Zeit von 1945 bis 1949. Es geht um ein Land zwischen Apokalypse und Aufbruch, um die Konfrontation der Deutschen mit den Gräueltaten des NS-Regimes, um das Schicksal jüdischer KZ-Überlebender. Im September waren die Künstlerinnen und Künstler mit einer Erinnerungs-Collage zu Gast in Chemnitz.
Biopolitik als Mainstream der 1930er Jahre?
mehrWie stand die Evangelische Kirche zu Eugenik, Zwangssterilisation und Krankenmord?
Das Deutsche Hygiene-Museum, die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung und die Evangelische Hochschule Dresden luden am 13.05.2025 zu einer Buchpräsentation und Podiumsdiskussion zur Biopolitik und der Haltung der Evangelischen Kirche ein. Zu diesem dunklen Kapitel deutscher Geschichte haben der Marburger Kirchenhistoriker Prof. Dr. Jochen-Christoph Kaiser und der Berliner Historiker Dr. Uwe Kaminsky nach jahrelanger Forschungstätigkeit die Quellenedition der Protokolle des „Ständigen Ausschusses für Rassenhygiene und Rassenpflege“ der Inneren Mission 1931–1938 herausgegeben.
Der fanatisch verlängerte Krieg
mehrEine Radtour durch den Schluckenauer Zipfel und die deutschen Nachbarorte erinnerte an die letzten Kriegswochen 1945, fanatische Durchhaltebefehle und die Folgen der Vertreibung
Kontrolle oder Freiheit – Queere Lebenswege in der DDR
mehrAm 25. März 2025 fand im Martin-Luther-King-Zentrum Werdau die Veranstaltung "Queer in der DDR – Gespräch mit Zeitzeug:innen und Expert:innen" statt. Die Veranstaltungsreihe von "Kontrovers vor Ort" beleuchtet in Kooperation mit der Sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, dem Landesverband Soziokultur Sachsen e. V. und dem Sächsischen Volkshochschulverband die Lebensrealitäten queerer Menschen in der DDR.
„Die Ostdeutschen und die Demokratie“
mehrBeim Politischen Nachtgebet am 12. Januar 2024 in der Dresdner Kirchgemeinde Weißer Hirsch referierten SLpB-Direktor Dr. Roland Löffler und der freie Journalist Michael Bartsch. Die Kirche war voll besetzt und nach den Vorträgen war der Diskussionsbedarf groß, die Zeit jedoch zu knapp. Daher wird der Abend am Freitag, 02.02. um 19.30 Uhr im Gemeindesaal fortgesetzt. Interessierte sind herzlich eingeladen. Den Redebeitrag des ersten Abends „Die Ostdeutschen und die Demokratie“ können Sie hier in voller Länge nachlesen.
Warum Sachsen eine Europäische Akademie braucht
mehrDr. Roland Löffler, Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung (SLpB), stellt am 7. Dezember 2023 auf dem Theodor-Litt-Symposium in Leipzig erstmals öffentlich das Konzept für eine Europäische Akademie in Sachsen vor. „Sie soll ein Ort sein, der Menschen zusammenbringt, vor allem aus dem Dreiländereck Sachsen/Deutschland-Tschechien-Polen.“ Hier stellen wir das komplette Manuskript seines Vortrags online, damit alle Interessierten die Rede nachlesen können.
„Unterdrückung findet in Belarus täglich statt“
mehrRund 80 Menschenrechts-Aktivistinnen und -Aktivisten aus über 20 Ländern kamen im Oktober in Leipzig zusammen, um sich im Rahmen der REVOLUTIONALE auszutauschen. Über mehrere Tage fand im Kupfersaal der Internationale Runde Tisch mit unterschiedlichen Gesprächsrunden statt. Kanstantsin Staradubets war einer der Teilnehmer. Er kommt aus Belarus, lebt zur Zeit aber in Litauen, und arbeitet für „Viasna”, die größte belarussische Menschenrechtsorganisation.
„Ich kann was verändern“ – Die REVOLUTIONALE in Leipzig
mehrRund 80 Menschenrechts-Aktivistinnen und -Aktivisten aus über 20 Ländern kamen im Oktober in Leipzig zusammen, um sich im Rahmen der REVOLUTIONALE auszutauschen. Über mehrere Tage fand im Kupfersaal der Internationale Runde Tisch mit unterschiedlichen Gesprächsrunden statt. Veranstaltet wurde die REVOLUTIONALE zum dritten Mal von der Stiftung Friedliche Revolution, Kooperationspartner waren 2023 u.a. das Europäische Solidarność-Zentrum Danzig, die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, die Stiftung Forum Recht und die Fernuniversität Hagen.