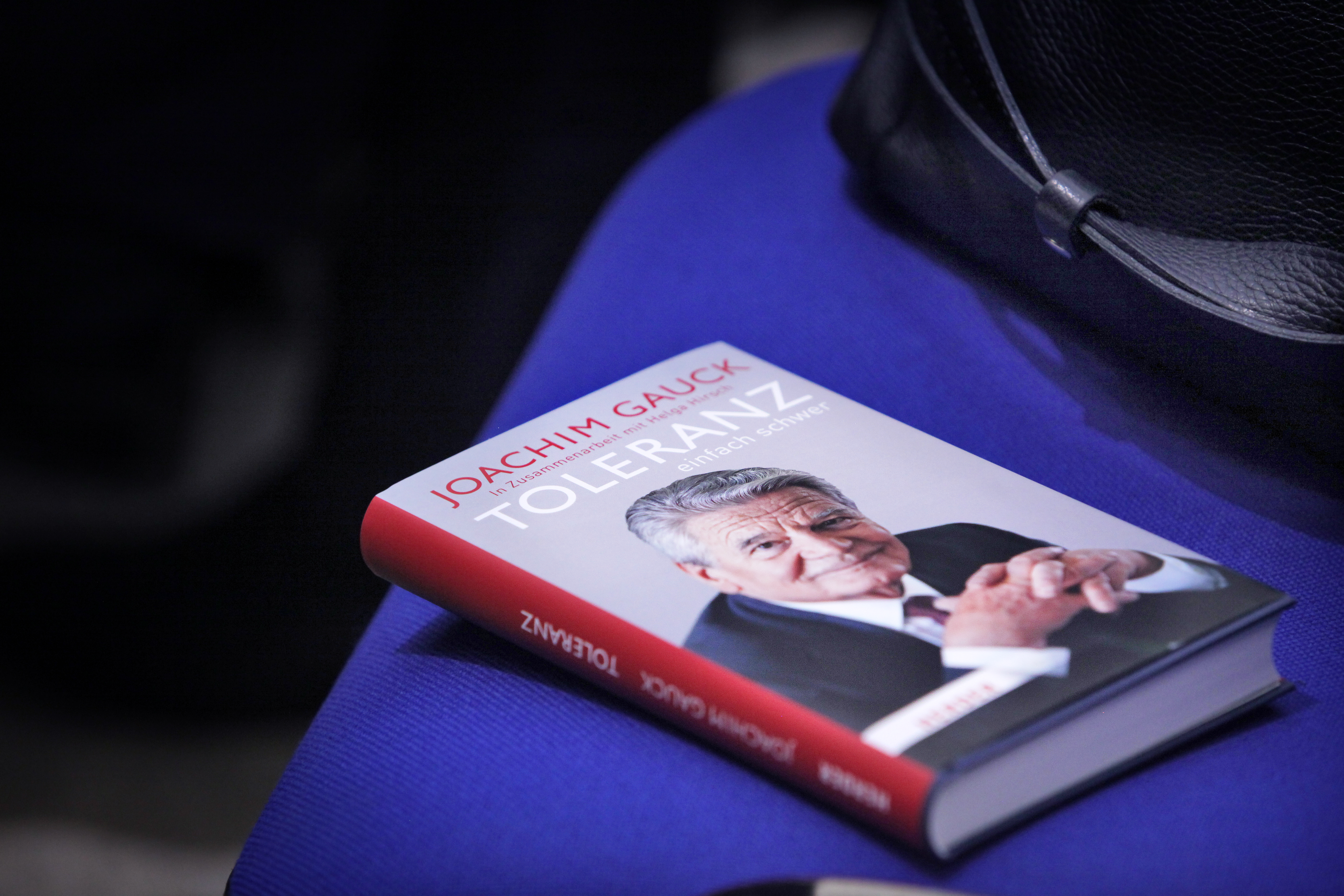Alles wird gut! Ihr müsst nur an Euch glauben, Euch etwas zutrauen und nicht vergessen, wie schlimm es damals in der furchtbaren Diktatur war. Auf diese Kurzformel ließe sich die auf eine Stunde verlängerte Quasi-Neujahrsansprache des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck am 4.Dezember im Albertinum bringen. Eine launige, mit Bonmots gewürzte freie Plauderei auf einer kleinen Showbühne im überdachten Innenhof. Und selbstverständlich keine Neujahrsansprache, sondern ein Vortrag auf Einladung gleich mehrerer Institutionen, voran die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen, die Landeszentrale für Politische Bildung und gastgebenden Staatlichen Kunstsammlungen.
Von einer „Ermutigung“ sprach danach Akademiedirektor Thomas Arnold, bevor er zum Dank einen Herrnhuter Adventsstern überreichte. Der anhaltende Applaus ließ auf das Bedürfnis nach solcher Ermutigung schließen. Nach einer Minute brach ihn der Redner selbst mit der Bemerkung „Das ist kein Parteitag!“ ab. Es hätte nur noch gefehlt, dass statt des wunderbar introvertierten Musikerduos „Land über“ Wolf Biermann sein „Du lass Dich nicht verbittern“ gesungen hätte.
Der Veranstaltungstitel „Unser Land. Vom friedlichen Zusammenwachsen in rauen Zeiten“ suggerierte die mögliche Überwindung von Ressentiments, Hass und Unversöhnlichkeit. Das Interesse am Thema und am Redner war angesichts mancher schmal besuchter Erinnerungsveranstaltungen an die Herbstrevolution 1989 ungewöhnlich groß. Die offiziell genannte Zahl von 850 Gästen war zwar um rund 200 zu hoch gegriffen, sie bleibt dennoch erstaunlich.
Leise Zweifel am postulierten friedlichen Zusammenwachsen ließ eingangs die Generaldirektorin der Kunstsammlungen Marion Ackermann erkennen. Teile der Bevölkerung stellten sogar die Grundwerte in Frage, konstatierte sie. Ihr Hinweis auf Diskussionen am Leipziger Grassi-Museum unter Polizeischutz fand seine Entsprechung in den Taschenkontrollen am Eingang zum Albertinum und in den Betonsperren an den umliegenden Weihnachtsmärkten. Misstrauen überall. „Die Furcht scheint kulturell zu dominieren“, bemerkte der ehemalige Bundespräsident in seiner Rede dann selber. Roland Löffler als Direktor der Landeszentrale für Politische Bildung griff zuvor den Veranstaltungstitel etwas zuversichtlicher auf. Er sprach von einem „rauen Land, das nichts mehr ersehnt als ein friedliches Zusammenleben“. Dazu könne ein „Labor der Debatten“ beitragen.
„DDR-Cliquen“ und Revolutionsromantik
Diesem Wunsch kam Joachim Gauck mit einer schwungvollen, durchaus volkstümlichen und unwiderstehlich optimistischen Rede entgegen. So fröhlich, dass man an der eigenen Wahrnehmung einer überwiegend pessimistischen, ja apokalyptischen Stimmung zumindest im Ostteil Deutschlands zweifeln musste. Damit die realen Errungenschaften nach 1989 gebührend zur Geltung kommen, erinnerte der Redner noch einmal an die politische Gleichschaltung und die wirtschaftlichen Problem in der DDR. Von Mecklenburger Familiengeschichten, vom Bruder, der wegen seiner Parteiferne nicht wie gewünscht zur See fahren durfte, gelangte Gauck über die Handlungsmuster von Anpassung und Gehorsam zur „Kultur der perpetuierten Ohnmacht“.
Die blühte freilich gar nicht so ohnmächtig in den Nischen vor allem der Kirchen und der Kultur. So ganz konnte sich auch ein Joachim Gauck die fast schwärmerische Erinnerung an die „Intensität in den Cliquen der DDR“ nicht verkneifen, die wir heute vermissen würden. Dass man aber die damals empfundene mitmenschliche Nähe nicht mehr brauche, sobald die Unterdrückung schwindet, wir also seinerzeit nur in Notgemeinschaft lebten, erscheint aus dem Mund eines ehemaligen Seelsorgers als eine gewagte These.
Unbestritten ist hingegen, dass besonders diese oppositionellen und manchmal nur trotzig-vitalen Kräfte den im Herbst 1989 kulminierenden Widerstand vorantrieben. Kein Wort kam indessen darüber, dass sie bald nach diesem Herbst in die Bedeutungslosigkeit versanken. Die D-Mark-trunkenen Wähler der ersten und letzten freien Volkskammer der DDR schickten das Bürgerrechtler-Bündnis 90 am 18.März 1990 mit nur noch 2,9 Prozent undankbar in die Wüste. Was Joachim Gauck nicht daran hinderte, noch einmal kräftig Revolutionsromantik heraufzubeschwören. Geradezu jugendlich wirkte der immerhin schon 79-Jährige dabei. Die Glücksgefühle von 1989 verglich er mit seiner ersten Verliebtheit als Schüler, schwärmte vom „schönsten Wort der Politikgeschichte: Wir sind das Volk!“. Der Seitenhieb auf jene, die diesen Ruf heute missbrauchen., folgte erst sehr viel später.
Der erste Beauftragte für die Stasi-Unterlagen 1990 kam noch einmal durch, als Gauck seinen damaligen Ärger über das Auftauchen der eigentlich verjagten SED in den neuen Parlamenten erwähnte. Was ihn Anfang Oktober 2019 nicht daran gehindert hatte, der Thüringer CDU zu empfehlen, ihre Abgrenzung gegenüber der dort sehr erfolgreichen Linken zu überdenken und „genauer hinzuschauen“. Kein Wort davon im Albertinum.
Die Furcht vor der Freiheit
In der weisen Schau auf die Unmöglichkeit ewiger Frischverliebtheit wie auch permanenten Revolutionsrausches aber folgten Passagen, die das Zuhören unbedingt lohnten. Wichtiger als die Erinnerungen an einen geradezu märchenhaften Aufbruch 1989 sei die Kraft, die heute aus ihnen wachsen kann. Was kommt nach der Romantik? Der frische Liebesrausch müsse auch in die Anstrengung münden, sich für zuständig zu erklären, verglich er erneut. Viele warteten nur auf Glück und Erlösung, irrten und suchten, während „das Glückszentrum doch in uns selber liegt“.
Damit war Gauck bei der heutigen Transformationsgesellschaft des Ostens, in der zwar die „DDR-Großbürokratien“ ihre Rolle verloren, viele Menschen aber ihre Rolle in der neuen Freiheit, in der offenen Gesellschaft noch nicht gefunden haben. Nicht nur hier, in ganz Europa „fürchten sich viele vor Wandel und Vielfalt“. Diese Flucht in die Vormoderne, die Sehnsucht nach Führung und Führer erklärt der frühere Theologe treffend mit einem bereits vom Psychoanalytiker Erich Fromm beobachteten Phänomen. Der seine Generation stark prägende Soziologe und Philosoph beschrieb die „Furcht vor der Freiheit“, die dem Wunsch nach einer Rückkehr ins Paradies als dem „Raum der Fürsorge“ entspringt.
„Es schadet nichts, ein Sachse zu sein“
Speziell im Osten verbinde sie sich mit der Bilanz von „nicht gelebtem Leben“, der ausgebliebenen Chance zu Selbstentfaltung und Selbststärkung. Folglich sehe man überall nur Bedrohungen, auch durch Ausländer. Ist also mit dem Jahr 1990 nicht nur Segen über uns gekommen? So weit ging Joachim Gauck denn doch nicht, neue Anpassungszwänge, neue Ängste zu konstatieren. Eine „Kolonisierung durch Westler“ sei außerdem nur eingebildet. „Liebe Wessis, wir sind Euch dankbar, dass Ihr uns nicht mit den Ossis allein gelassen habt“, meinte der Redner.
Nach den Erklärungsversuchen für den nicht zu übersehenden Frust gegenüber der Demokratie und dem „System“ – wie schon vor 1933 – zeigte Gauck aber wenig Verständnis für die so empfindenden Menschen. Seine Ermunterung für das Auditorium bestand vielmehr darin, in den Skeptikern, gar Feinden einer offenen Gesellschaft eine Minderheit zu sehen. „Eine Mehrheit würde entscheiden, dass wir sie nicht brauchen und dass sie überflüssig sind“, gab er speziell den Pegida-geplagten Dresdnern mit.
Das klang nicht gerade nach Zusammenwachsen einer zerrissenen Gesellschaft. Andererseits wollte Joachim Gauck zum Schluss den „Leuten von vorgestern Argumente abverlangen“, plädierte für Geduld und dafür, „mit den Zweiflern zu reden“.
Zweifeln sollten schließlich auch die Sachsen nicht an sich selbst. „Es schadet nichts, ein Sachse zu sein“, spendete der bekennende Norddeutsche einen letzten Trost.