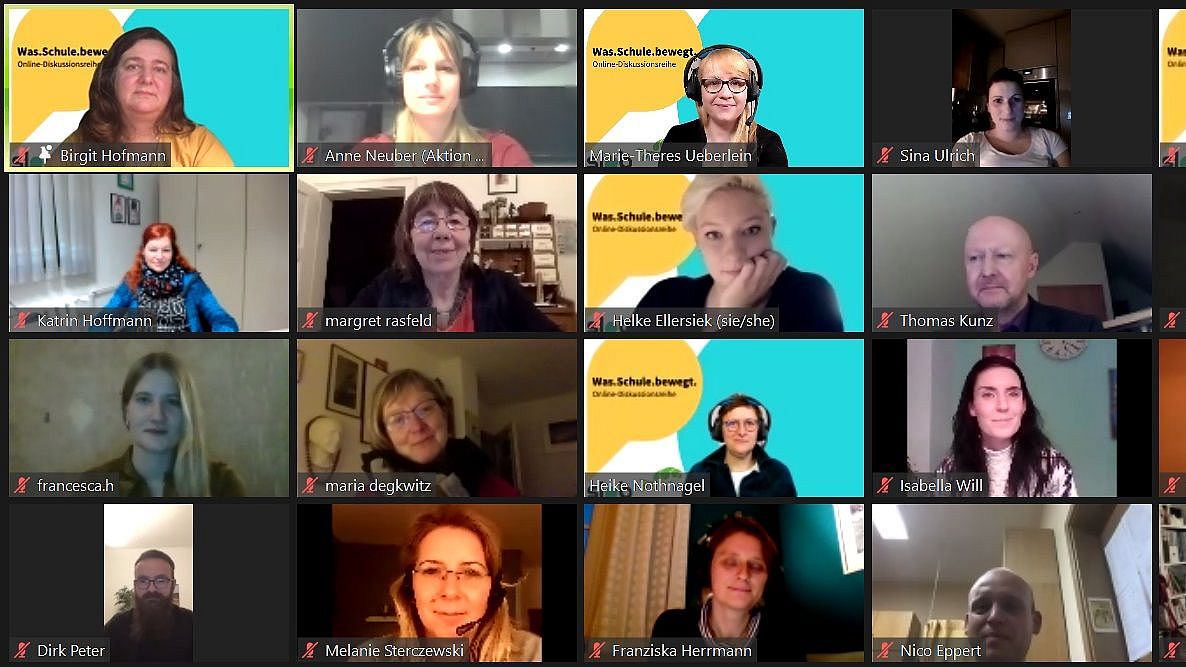Seit Pandemiebeginn steht das Thema Schule immer wieder im Zentrum der Debatte. Dabei ist vor allem eins klar geworden: Corona macht wie unter einem Brennglas die Defizite sichtbar, die es in den Schulen schon vorher gab – und die sich jetzt in der Krise zuspitzen. Herausforderungen in der Digitalisierungspraxis, überlastetes Lehrpersonal, vernachlässigte emotionale und politische Bildung – was vorher schon schwierig war, wird in Zeiten von Schulschließungen und Homeschooling zum brennenden Problem. Und ausgerechnet jetzt gibt es in Zeiten geschlossener Lehrerzimmer und abgesagter Kongresse keinen Ort mehr, an denen die Akteure zusammenkommen können, um allgemeine Probleme zu diskutieren.
Die Veranstaltungsreihe „Was.Schule.bewegt“ der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung will das ändern. In Kooperation mit der Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen schafft die SLpB für diese Fragen und Debatten einen Raum, in dem schulische und außerschulische Akteur:innen zusammenkommen. Seit Ende Januar werden jeden Donnerstag um 16 Uhr für anderthalb Stunden lang Probleme und Ideen rund um das Thema Schule diskutiert, moderiert von SLpB-Referentin Heike Nothnagel, gemeinsam mit Referentinnen der Schulstiftung und Veranstaltungsassistentin Marie-Theres Ueberlein.
Was bewegt mich, was kann ich bewegen?
Der Moderation ist in der Reihe vor allem wichtig, nicht nur in der reinen Problembeschreibung stehen zu bleiben, auch wenn die Lage dazu verlockt. Vielmehr ist Ziel der Veranstaltungsreihe, Ideen auszutauschen, Lösungen zu finden und sich zu vernetzen. Der Bedarf danach ist groß, wie die Nachfrage nach den ersten fünf von insgesamt zehn Veranstaltungen zeigt: Sie alle waren wegen großer Nachfrage innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. Nach der ersten Sitzung zu 25 Teilnehmenden hat die SLpB die Kapazität deshalb erweitert – um die 40 Teilnehmenden nahmen an der zweiten Sitzung teil.
Damit trotz der Gruppengröße noch ein sinnvoller Austausch möglich bleibt, werden die Gruppen nach unterschiedlichen Methoden aufgeteilt – mal durch Fishbowl-Diskussionen, mal durch Breakout-Sessions, also durch Kleingruppen innerhalb der Zoomkonferenz, in denen sich die unterschiedlichen Konstellationen an Bildungsakteurinnen und -akteuren zusammenfinden können. Der Titel „Was.Schule.bewegt“ ist dabei Programm im doppelten Sinne. Er fragt: Was bewegt mich? Aber auch: Was kann ich bewegen?
Ausgehend von diesen Fragen sind die ersten sechs der zehn angesetzten Veranstaltungen nun wie im Flug vergangen. Wegen des hohen Gesprächsbedarfs wurde dem Thema Digitalisierung genau wie dem Thema Antisemitismus zwei Sitzungen gewidmet. Keine Sekunde zu viel, wie sich herausstellte: Angeregt kamen außerschulische Akteurinnen und Akteure mit schulischen ins Gespräch. Schulleiterinnen und -leiter von Grund-, Mittel und Berufsschulen, Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter, Bildungsreferentinnen und -referenten, Workshopleiterinnen und -leiter, Gründerinnen und Gründer außerschulischer Initiativen brachten ihre Expertise und Erfahrungen ein. Viele waren dabei in der Doppelrolle, gleichzeitig noch Kinder zu haben und so auch die Elternsicht zu kennen auf das, was läuft – und das, was so gar nicht klappt.
„Wir müssen über die Bedeutung von Beziehungsarbeit reden“
Besonders hat die Teilnehmenden in den beiden Digitalisierungssitzungen vom 21. und 28. Januar bewegt, wie man die Kinder dazu motiviert, im Homeschooling weiter am Lernstoff dranzubleiben und nicht aufzugeben. Soll man sie zusätzlich anrufen? Mails schreiben? Sind sie davon genervt oder schafft das mehr Bindung? Gemeinsam in den Schultag zu starten und ihn zu beenden sei gut angenommen worden, berichtet eine Teilnehmerin. "Morgens etwas zusammen zu singen oder vorzulesen schafft engmaschigen Kontakt, manche Kinder nehmen mittlerweile sogar etwas auf und spielen es in der morgendlichen Begrüßungskonferenz vor."
Der Vorschlag wird erfreut in der Runde aufgenommen. Denn viele hier haben Sorge, dass der persönliche Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern verloren geht. Lehrende berichten von einem dauerhaften Gefühl des Unbefriedigtseins – wie geht man damit um, dass man digital nicht schafft, alles zu kompensieren? Welche weitere Ungleichheit wird durch das virtuelle Klassenzimmer erzeugt? Worauf muss mehr eingegangen werden? Oft fehlt etwa Stabilität in der Internetverbindung, wenn die Kinder etwas ländlicher wohnen. Manche fahren dann doch bei ihnen vorbei, werfen die Aufgaben in den Briefkasten und versuchen, über kurze Gespräche am Gartenzaun zu motivieren.
Die Beziehungsarbeit, so zeigt sich im Laufe der Gespräche, ist in diesen Zeiten wichtiger denn je, die emotionale Bindung entscheidet oftmals mit darüber, welche Schülerinnen und Schüler im Laufe des Schuljahres wegbrechen und welche nicht. "Wir müssen über Wert und Bedeutung von Beziehungsarbeit reden, in Zeiten von häuslicher Lernzeit und Schule auf Distanz ist das wichtiger geworden", appelliert ein Schulleiter an die Runde. "Das hat dringenden Fortsetzungsbedarf nach der Pandemiesituation." Wenn rein kognitiver Stoff und eine frontale Art des Unterrichtens einfach beibehalten würden, stiegen viele Kinder aus, mahnt eine Teilnehmerin. "Alte Schule einfach digitalisiert zu denken, funktioniert nicht."
Dabei sei gerade jetzt die Chance hoch, die Kinder über Projekte für den Stoff zu begeistern, macht eine Lehrerin den Teilnehmenden Hoffnung: Oft sind halbe Klassen in Präsenz, genau jetzt könnten diejenigen, die nicht in der Schule sind, Projektarbeiten umsetzen. Außerschulische Bildungsakteure könnten dabei mit ihren Angeboten die Lehrenden entlasten, sie haben Formate, mit denen sie gut unterstützen können, erzählen sie der Runde.
„Digital kann man nicht schweißen lernen“
Doch sei es momentan schwierig, an die Zielgruppen dranzukommen. Es herrsche Unsicherheit, wie und an wen man sich in dieser für alle Lehrenden stressigen Zeit mit Projektangeboten und Themen wende, ohne noch mehr Belastung zu sein, wo man doch Erleichterung bringen kann. "Am besten sollten Projektangebote so gebrauchsfertig wie möglich angeboten werden", empfiehlt eine Lehrerin, "sodass man einfach loslegen kann." Im Zoom-Chat werden schon die ersten Kontakte ausgetauscht, das Angebot wird dankbar aufgenommen – die Vernetzung läuft an.
Und doch bleiben Probleme in der Schule unter Pandemiebedingungen, die in zwei Sitzungen nicht gelöst werden können. Besonders in Ausbildungen fehlt im Digitalschuljahr schlicht die Praxis. "In praktischen Ausbildungen bringt es nichts, was übers Schweißen zu lesen", sagt eine Berufsschullehrerin, "die brauchen die praktische Erfahrung! Digital kann man nicht schweißen lernen." Die digitale Lehre, das ist allen hier klar, kann nur eine vorübergehende Lösung in Pandemiezeiten sein, sie wird die Präsenzlehre nicht ersetzen.
Und selbst dort, wo es gute digitale Möglichkeiten gibt, bleibe das Problem, dass viele Lehrende mit dem teuren Equipment, das ihre Schule angeschafft hat, nicht sinnvoll umgehen können – eine Erfahrung, die hier viele teilen. Doch am Ende bleibt von der Runde der Ausblick: Digitalisierung und Medienkompetenz sind nicht Kern einer konstruktiven Schulentwicklung, sondern Mittel zum Zweck. Kernaufgabe der Schule sei vielmehr, selbstständig denken und arbeiten zu lernen – auch, um Krisen wie die Pandemie gut zu überstehen. "Kinder müssen lernen, mit Krisen umzugehen, nicht nur mit Corona, auch mit der Klimakrise. Der Schlüssel ist dabei, kreativ und lösungsorientiert zu denken. Wenn wir nur auf der kognitiven Ebene reden, kriegen wir weder Kinder noch Eltern mit." Es brauche einen Paradigmenwechsel in der Ausrichtung von Schule, "Digitalisierung kann da ein super Diener sein."
"Antisemitismus ist keine Frage des Bildungsstandes"
Dass die Schule der entscheidende Ort für Herzensbildung und selbstständiges Denken sein muss, ist auch Ergebnis der zweiten großen Doppelsitzung in der Reihe. In den Sitzungen vom 4. und 18. Februar diskutierten die Teilnehmenden – in teils neuer Zusammensetzung – das Thema Antisemitismus an Schulen. Nicht zuletzt durch Popkultur und digitale Medien sei "Du Jude" längst zum populären Schimpfwort auf den Schulhöfen geworden. Ein Teilnehmer, der beruflich Workshops zu Verschwörungsmythen an Schulen gibt, berichtet, wie hoch das Wissen schon bei den Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse über antisemitisch konnotierte Verschwörungsmythen sei.
"Oft werden die Stereotype schon in der Familie geprägt", sagt eine Teilnehmerin, "aber auch über Youtube oder über Rap." Viele in der Runde ernten im Schulbetrieb als Reaktion auf das Thema Shoah ein kollektives Stöhnen und sich immer wiederholende Sätze: "Schuld am Holocaust waren meine Großeltern, nicht ich, warum muss ich mich damit beschäftigen?", heiße es dann. In der Runde verspüren viele eine große Ohnmacht angesichts dieser Reaktionen, insbesondere, weil die Abwehr nicht allein von den Lernenden, sondern oftmals ebenso von den Eltern und den Lehrenden komme – bis hin zur Schulleitung.
Gleiches gelte für antisemitische Aussagen, berichten einige. "Antisemitismus ist keine Frage des Alters oder des Bildungsstandes" – darauf können sich die Seminarteilnehmenden schnell einigen. "Wenn das Thema der Schulleitung egal ist oder sie nicht hinter einem steht, kann man sich schnell die Zähne ausbeißen", sagt eine, die Workshops anbietet für genau diese Fälle. Auch hier werden schnell wieder Kontakte und Links getauscht, Angebote vorgestellt. Oft fehlt das Wissen, an wen man sich wenden soll – auch dafür sind die Zoomrunden ein Forum, um sich zu vernetzen und Angebote kennen zu lernen, die sonst die Schule nicht erreichen.
„Schulen sind viel zu oft kein Ort der Empathie“
Wie soll man das Thema Antisemitismus in den Klassen- und Lehrerzimmern also nun angehen? "Vielleicht das kollektive Stöhnen als Gesprächsanlass nehmen – warum stöhnt ihr, was steckt dahinter?", ist ein Vorschlag. Viele hier haben auch gute Erfahrungen mit Zeitzeugenberichten gemacht. "Die Berichte zu hören und die Wahrnehmungen real zu machen, statt sie auf die Großelterngeneration zu schieben, das hat sehr gut funktioniert", berichtet eine. Sie empfiehlt Fahrten in Gedenkstätten mit guten Konzepten und durchdachter Vorbereitung durchzuführen.
In der Runde wollen viele ihre Schüler:innen auch dafür sensibilisieren, Jüdinnen und Juden nicht allein in der historischen Opferperspektive kennen zu lernen, sondern Berührungspunkte mit dem alltäglichen jüdischen Leben zu schaffen. Dass es etwa in Chemnitz eine Synagoge gibt, habe die jungen Leute in seinem Workshop überrascht, erzählt ein Teilnehmer. Auch Klassenfahrten nach Israel werden diskutiert. Bildungsträger wie das Ariowitsch-Haus in Leipzig stellen ihre Programme vor, was auf großes Interesse stößt. Auch Vertreterinnen und Vertreter des SMK und des LASUB beteiligen sich an den Diskussionen und verweisen auf konkrete Angebote und Materialien im Themenbereich Politische Bildung in Schule und Unterricht. Die Bereitschaft für unterschiedliche Herangehensweisen ist in der Runde so hoch wie die Angebote breit. Viele wünschen sich einen ganzheitlichen Ansatz, der über den reinen Geschichtsunterricht hinausgeht.
Ein Teilnehmer weist in dem Zusammenhang auch darauf hin, dass Antisemitismus nicht einfach eine Verhaltensform sei, sondern als Massenphänomen eine kollektive Haltung hervorgebracht hat, die den Nationalsozialismus erst hervorbringen konnte, und der immer noch tief in der Gesellschaft steckt. Er zitiert den Soziologen Samuel Salzborn, der sagt, Antisemitismus sei die "Unfähigkeit, abstrakt zu denken und konkret zu fühlen". Insbesondere letzteres lerne man viel zu selten in der Schule, sagt ein Schulsozialarbeiter in der Runde: "Schulen sind viel zu oft kein Ort der Empathie."
„Das Schulsystem ist stärker als individuelles Engagement“
Die Reaktionen in der Runde sind bestürzt, aber zustimmend. Eine ehemalige Schulleiterin berichtet von einer Gedenkstunde, die ihre Schule nach dem antisemitischen Rohrbombenanschlag in Düsseldorf im Jahr 2000 gehalten hat. "Schule darf nicht nur kognitiv bilden, sie muss auch Herzensbildung geben. Wer bei so einem Ereignis sagt, seine Mathe- oder Deutschstunde sei jetzt wichtiger, erzieht auch zur Beliebigkeit." Gleichzeitig liege das Problem im Schulsystem, das stärker sei als einzelne, politisch engagiert Lehrende. "Die Ursache von Diskriminierung ist eine Betonung von Ungleichwertigkeit, und wir haben leider ein Schulsystem, das auf Ungleichwertigkeit ausgerichtet ist", sagt sie. Ihr Verweis auf die internationale Kampagne "Bildung für Nachhaltige Entwicklung" (BNE) wird von den Moderatorinnen ins Programm aufgenommen und am 4. März an einem eigenen Thementag besprochen, unter dem Titel: "BNE – Ist das wichtig oder kann das weg?"
Für weiterführende Informationen zur Dialogreihe wenden Sie sich gern an: heike.nothnagel(at)slpb.smk.sachsen(dot)de